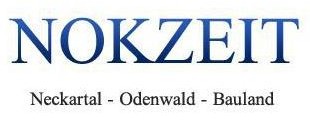(Symbolbild – Pixabay)
Was die neuen Regeln für den Mittelstand bedeuten
Eine ganze Zeit lang war eine gute Digitalisierungsstrategie und ein Mitgliedsstatus in der EU eher Korrelation. Länder wie Deutschland bleiben schon seit langem weit hinter ihrem digitalen Potential zurück. Laut dem „State of the Digital Decade“-Bericht der EU-Kommission zeigt, dass nur die Hälfte aller Europäer über grundlegende digitale Fähigkeiten, wie das differenzieren zwischen Falschinformationen, wie Deep Fakes oder KI-generiertem Content und seriösen Nachrichten, verfügen. Deutschland liegt hier im Mittelteil – und das ist gemessen an der Wirtschaftsstärke nicht gut.
Die EU will dieses Problem nun angehen. Bereits seit 2024 mit dem Digital Services Act (DSA) und nun mit dem Pilotprojekt zur EUDI-Wallet und zusätzlichen neuen Verbraucherschutzrichtlinien starten sie eine starke Offensive für eine Korrektur des Tempos europäischer Digitalisierung. Insgesamt wird die EU rund 288 Milliarden Euro in verschiedenste Digitalisierungsprojekte stecken – und dieses Geld kommt nicht nur Großkonzernen und Regierungen zugute. Auch für regionale Unternehmer lohnt es sich, genauer in die Pläne der EU zu sehen und davon zu profitieren.
Einheitliche Regeln, weniger Bürokratie
Ein großes Problem an internationaler Zusammenarbeit innerhalb der EU ist, dass einheitliche Regelungen fehlen. Das eine Land benötigt diese Formulare, das andere muss andere Vorgaben erfüllen und so weiter. Die EU plant, zumindest im digitalen Raum Angebote zu schaffen, die diese Systeme vereinfachen. Mit der EU Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) soll es möglich sein, eine europaweit standardisierte Identitätsprüfung zu etablieren. Auch der Digital Services Act versucht, verschiedene Regularien und Vorgaben innerhalb Europas auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Es wird versucht, verbindliche Minimalkriterien zu etablieren, an die sich alle Online-Plattformen und digitale Dienste halten müssen. Somit gibt es eine gewisse Rechtssicherheit, gerade für kleinere Anbieter und Unternehmen, die dafür keine Ressourcen haben.
Vielfalt bleibt gewollt
So gut das alles klingt, haben dennoch viele Unternehmer Bedenken, dass diese Richtlinien zu einer zu starren Vereinheitlichung führen. Das ist allerdings überhaupt nicht das Ziel. Der EU geht es darum, nachhaltige Ressourcen und Infrastruktur zu schaffen, damit jedes EU-Land die gleichen oder zumindest ähnliche Chancen hat, jetzt mit dem Tempo anzuziehen. Prinzipielle Pflichten zur Digitalisierung oder ähnliches sind nicht Teil der neuen
Viele Unternehmer fürchten, die neuen EU-Regeln könnten zu starrer Vereinheitlichung führen. Doch Harmonisierung bedeutet nicht Gleichschaltung. Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung bleibt bestehen – unterschiedliche Wege sind erlaubt, solange die EU-Standards eingehalten werden.
Besonders klar wird das im Bereich von Online Glücksspielanbietern. In Deutschland regelt seit 2021 die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, oder auch GGL, alle Möglichen Prozesse im Online Glücksspiel. Und die GGL hat den Ruf, ziemlich sicher, aber auch streng zu sein. Diese Regeln gelten aber nicht europaweit und nur weil man in einem Casino spielt, das nicht durch die GGL lizensiert ist, bedeutet das nicht, dass man sich auf unsicheres Terrain begibt. In ganz Europa gibt es verschiedenste seriöse Lizenzvergeber, wie die Malta Gaming Authority oder die Isle of Man Gambling Supervision Commission, die ihre eigenen Regeln und Sicherheitsmechanismen haben. Und das ist auch gut so und ganz im Sinne der EU – Prozesse sollen einfacher und besser geregelt werden, ohne die Vielfalt zu gefährden.
Drei Schritte, die sich lohnen
Zunächst ist es wichtig, sich ein realistisches Bild zu machen. Wie gut ist die Bandbreite? Gibt es flächendeckend gleich gutes Netz im Unternehmen? Haben wir eine ausreichende IT-Abteilung und hat diese genügend Kapazitäten, um sich um Probleme und kommende Transformationen zu kümmern und zu unterstützen? Das alles sind Fragen, die glasklar beantwortet werden müssen. Wenn nicht klar ist, wo es hadert, weiß man nicht, wo zuerst angesetzt werden muss.
Um sich dieses Bild überhaupt verschaffen zu können, ist es wichtig, die Mitarbeiter auszubilden und digitale Kompetenzen zu fördern. Nicht jeder Mitarbeiter muss gleichermaßen digitaler Alleskönner sein, aber grundlegende Verständnisse für Technologien, wie Cloud-Speicher, KI oder Big Data sind essenziell. Der Wandel wird kommen und es ist wichtig, dass jeder im Unternehmen in der Lage ist, sich anzupassen und bei der digitalen Transformation zu helfen.
Und zu guter letzt: EU-Förderungen beantragen. Informieren Sie sich schnell, welche Programme in der Umgebung zum Unternehmen passen und wie man sich für diese Programme qualifiziert. Die Umsetzung von Digitalisierungszielen kann teuer sein, aber genau deshalb hat die EU beschlossen, kleinen sowie großen Unternehmen unter die Arme zu greifen.
Jetzt aber ran an den Rechner
Es scheint, als habe die EU nicht nur endlich begriffen, wie wichtig eine gute und koordinierte Digitalisierungsstrategie ist, sondern dass sie sich auch bemüht, diese durchzusetzen. Durch einheitliche Regelungen und Förderprogramme, wo sie gezielt gebraucht werden, ist seit langem wieder einmal Hoffnung auf internationalen Anschluss angebracht.
Für kleinere Unternehmen bedeutet das aber vor allem eins: Ran an den Speck. Die Förderprogramme sind JETZT verfügbar und wer nicht jetzt auf den Zug aufspringt, wird gnadenlos abgehängt. Die Chancen und Hilfsangebote sind so vielversprechend wie nie – jetzt liegt es an uns, sie zu nutzen.