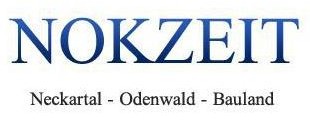(Foto: Liane Merkle)
Mudau. (lm) „Mir babbele heijt wie uns de Schnabel gwachse is, unn alleweil fange mer a“, begrüßte der Odenwälder Mundart-Papst Hans Slama sein interessiertes Publikum.
In einer Podiumsdiskussion mit Sprachforscherin Dr. Isabell Arnstein, Minister Peter Hauk, dem ehemaligen Rektor des BGB, Roland Grimm, sowie Rektor Jochen Schwab stellte Slama die Frage in den Raum: „Dialekt – Heimat zum Mitnehmen?“
Ein Fragenkatalog von Dr. Arnstein, zeigte, dass den meisten Anwesenden ihre jeweilige Mundart überaus wichtig ist, dennoch wird sie überwiegend im Familien- und Freundeskreis gepflegt, und wie der Abend zeigte, waren die meisten Anwesenden in einer „zweisprachigen“ Zeit aufgewachsen, wo Zuhause Dialekt normal, in der Schule jedoch Schriftdeutsch Pflicht und die Mundart verpönt war, denn laut Jochen Schwab – auch ein ehemaliger Zweisprachler – hatte Mundart damals „keinen guten Klang“.
Man wurde als weniger intelligent eingestuft. Und obwohl die Mundart inzwischen durchaus salonfähig ist, wird sie in den Familien heute kaum mehr gepflegt. Hans Slama konnte vom steten Ausbau des schon sehr beliebten Mundartwegs mit seinen inzwischen 60 Tafeln ebenso schwärmen wie von den zahlreichen Mundartveranstaltungen, die immer sehr gut besucht seien, und den Workshops in Schulen mit begeisterten Kindern und dem Fazit: „Dialekt ist das Salz in der Suppe des Lebens“.
Minister Hauk, der den Klang seiner Heimat nie ganz versteckt hat, merkte während seiner Rippberger Begrüßung schnell, wie schwer eine öffentliche Rede komplett in der Muttersprache sein kann. Als Verfechter des Dialekts betonte er die besondere Vielfältigkeit in Klang und Aussprache im Neckar-Odenwald-Kreis, bedauerte aber auch, dass die Menschen im ländlichen Raum heute nicht mehr auf Anhieb heraushören können, woher ein Mensch kommt.
Er plädierte für eine positivere Einstellung zum eigenen Dialekt, denn „es sind die Unterschiede, die zu einem lebendigen Dialog führen.“ Dr. Arnstein beschrieb in einer sprachwissenschaftlichen Präsentation wie die Unterschiede eingeordnet werden.
Abonnieren Sie kostenlos unseren NOKZEIT-KANAL auf Whatsapp.
„Maus, Haus, Ais“ beschreibt demnach das Fränkische, „Mous, Hous, Eis“ das Schwäbische und „Muus, Huus, iis“ das Allemannische, und nur der Badische Odenwald als Grenze zwischen dem sprachlichen Süd- und Ostfränkisch beschreibt eine sogenannte „Hausch-Mausch-Insel“, denn nur hier wird das S zum „sch“.
Wie sehr sich Sprache und Dialekt verändert oder auch weiterentwickelt, zeigte Roland Grimm anhand einer Geschichte auf, in der vor 100 Jahren noch der Abtritt eine Rolle spielte, der 50 Jahre später bereits als Klo bezeichnet wird. Zurückzuführen sei die sprachliche Entwicklung auf die Veränderungen in der Gesellschaft.
War man früher in seinem Geburtsort auch gestorben, so hätten sich mit wachsender Mobilität auch die „Umwälzungen“ in einem Dorf mit verschiedenen Sprachen erhöht. Es wird schwieriger, die Herkunft eines Menschen „herauszuhören“.
Dialekt zu bewahren, hat jedoch viele Vorteile, denn mit ihm kann man sich einfach bildlicher, lebendiger und empathischer ausdrücken als im sterilen Schriftdeutsch. Minister Hauk brachte es auf den Punkt: „Es ist wie beim Denkmalschutz – man merkt, der Dialekt wird rar und man muss was tun!“
Wie das funktionieren kann beschrieb Andreas Schmitt – eigentlich Halbmigrant – in seinem Gedicht „Semmer Lembocher odder semmer keene“, das zeigt wie auch gebürtige Spanier, Rumänen und Libanesen sich im Limbacher Dialekt in diese örtliche Gemeinschaft ebenso wie in Mundart-Workshops an Schulen stolz und zugehörig einbringen.
Das Kurpfälzische lobte mittels Gedicht und Gitarre der Mundartpreisträger Roland Beigel mit seinem unnachahmlichen „Ich schwätz Parlantinal“, was dem Abend eine neue Klangfarbe hinzufügte.
Ganz sicher waren sich alle anwesenden Mundartliebhaber, dass der Erhalt des Dialekts und seiner Wertschätzung aller Mühen wert ist, und allen Altersklassen in Veranstaltungen, Workshops, über die sozialen Medien den Menschen wieder näher gebracht werden sollte.
Schon Harald Hurst hatte erkannt, dass sein „Lappeduddel“ mit einem Wort mehr und bildlicher beschreiben kann als der „antrieblose Mensch“ im Schriftdeutschen. Im Dialekt hört man einfach besser, wie die Menschen sich gerade fühlen. Und natürlich waren sich alle am Schluss einig: „Der Dialekt ist selbstverständlich ein Stück Heimat zum Mitnehmen!“