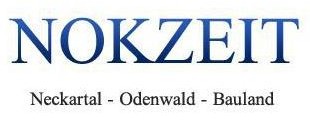MdB Sylvia Kotting-Uhl sprach in Mosbach
Mosbach. (pm) Gerade an Atomenergie-Standorten ist die Bevölkerung sensibel für Fragen wie die nach der Lagerung radioaktiver Abfälle. So folgten rund 30 Gäste in Mosbach den Ausführungen von MdB Sylvia Kotting-Uhl. Die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen ist Mitglied der Endlager-Kommission. Nach ihrem Vortrag war klar, wo sie die neue Qualität der Endlagersuche sieht: Die Kommission soll ein Verfahren für die Suche entwickeln, bei der nicht nur technische, geografische oder geologische Kriterien berücksichtigt werden, sondern auch ethische und gesellschaftliche Belange. Die Zusammensetzung des Gremiums aus 34 Personen ist ein Abbild dieser Zielsetzung. Neben den beiden Vorsitzenden gehören der Kommission je acht Mitglieder der Landesregierungen und des Bundestags an. Ausschließlich die Vertreter der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft – entsandt von Gewerkschaften, Kirchen, Umweltverbänden und der Atomwirtschaft – haben Stimmrecht.
Diese Besetzung zeige schon, dass sich gegenüber bisherigen Entscheidungswegen im Umgang mit Atommüll Entscheidendes verändert habe: „Wir führen die gesellschaftliche Debatte vor der parlamentarischen“, erklärte Kotting-Uhl vor kompetentem, kritischem Publikum. Diese gesellschaftliche Dimension berge viele Möglichkeiten des Scheiterns, aber auch Chancen, dass die große Aufgabe gelinge.
Die Frage der Konzepte für die Endlagerung kam auch in Mosbach zur Sprache: Soll der Atommüll tiefengeologisch gelagert und verschlossen werden? Kotting-Uhl hält das nicht für erstrebenswert: „Es gilt das Prinzip der Rückholbarkeit, das ist Voraussetzung für die Akzeptanz“, findet sie und diskutierte mit einem Bergmann aus dem Publikum die Unberechenbarkeit strahlender Abfälle. Neben diesen technischen Fragen hätten die Erfahrungen mit Atommüll-Lagern in Gorleben, Morsleben oder Asse – „da fühle ich mich als Karlsruherin mitverantwortlich“ – gelehrt, dass die Öffentlichkeit am Such-Prozess beteiligt werden müsse. Diese Beteiligung will Kotting-Uhl unter allen Umständen fortentwickelt sehen.
Im Zuge des Verfahrens werde der Bundestag Schritt für Schritt Beschlüsse fassen, aus denen sich eine Eingrenzung möglicher Standorte ergebe. Erst wenn reale Standortvorschläge auf dem Tisch liegen, werde die Beteiligung Betroffener lebendig. Schon jetzt setze man sich in der Kommission mit Fragen auseinander, die dann gestellt werden: Unter welchen Bedingungen kann eine Kommune ein Endlager akzeptieren? Und wenn es so wäre: Hat dann eine Region ein Vetorecht? Die Politikerin ist dafür, ebenso wie sie die Einrichtung eines öffentlich-rechtlichen Fonds für Rückstellungen zur Finanzierung der Endlagerung befürwortet. Nach dem Verursacherprinzip müssen dazu die großen Energieversorgungsunternehmen (EVU) herangezogen werden.
Ob diese genügend Rückstellungen gebildet haben, ist neben juristischen Auseinandersetzungen und Klangen einer von vielen Streitpunkt in der Kommission. Schließlich, so Kotting-Uhl, „ist völlig unklar, was das alles kosteten wird“. Höchstmögliche Sicherheit habe bei allen Entscheidungen Vorrang. Froh ist sie über den Konsens, dass eine bundeseigene Gesellschaft die operative Arbeit, die eigentliche Standortsuche, leisten soll.
Als „gute Botschaft“ wertete Kotting-Uhl die Abkehr großer Energiekonzerne wie Eon von der Atomkraft. Wenn die EVU zunehmend in erneuerbare Energien investieren, sei das ein Signal an Länder, die noch an alten Technologien festhalten: „Deutschland kriegt den Ausstieg hin.“ Dennoch wurde deutlich, dass am Ende der Endlagersuche nicht zwingend eine Lösung steht.