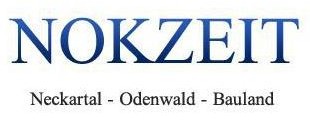(Foto: Brauch-Dylla)
Große Resonanz auf Einladung von Reinhold-Maier-Stiftung und Stadt
Adelsheim. (bd) Ein proppevoller Rokokosaal, aufmerksame Zuhörer und reichlich Gesprächsbedarf: Am Mittwochabend stellte die Journalistin und Autorin Ira Peter im Schloss Adelsheim ihr Buch „Deutsch genug? – Warum wir endlich über Russlanddeutsche sprechen müssen“ vor.
Eingeladen hatten die Reinhold-Maier-Stiftung, Schlossbesitzer Louis von Adelsheim und Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Der große Andrang zeigte, wie sehr das Thema auch im Bauland bewegt.
Zwischen Vorurteilen und kultureller Offenheit
In seiner Begrüßung betonte Bernhardt, dass es um bislang selten gehörte Geschichten gehe. Louis von Adelsheim erinnerte an die Tradition kultureller Offenheit seines Hauses. Programmmanagerin Julia Frank hob den Anspruch der Stiftung hervor, gesellschaftlich relevante Debatten auch in ländliche Regionen zu tragen.
Das Thema Russlanddeutsche, so Frank, halte der Gesellschaft oft den Spiegel eigener Vorurteile vor. Der Abend solle dazu beitragen, diese Bilder zu hinterfragen und zu korrigieren.
Erinnerungen zwischen Kasachstan und Bauland
Ira Peter, 1983 in Kasachstan geboren, lebt seit 1992 in Deutschland. Ihre Familie fand in Buchen im Wohngebiet Nahholz ein neues Zuhause – von vielen als „Klein-Kasachstan“ bezeichnet.
Mit eindringlicher Stimme schilderte sie die Lebenswirklichkeit nach der Deportation ihrer Familie aus der Ukraine in die kasachische Steppe unter Stalin. Allen Russlanddeutschen sei der Verlust von Heimat und Angehörigen gemeinsam.
Auch der Neustart in der Bundesrepublik war schwierig. „Für mich als Kind war es einfach der Umzug ins Gummibärchenland“, erinnerte sich Peter. Doch hinter der anfänglichen Begeisterung steckte ein anstrengender Balanceakt zwischen Identität und Integration.
Abwertende Bemerkungen wie „die hatten in Russland vielleicht ’nen deutschen Schäferhund“ spiegelten eine subtile Ablehnung wider. Viele Russlanddeutsche hätten sich gefragt, ob oder wann sie „deutsch genug“ seien. Hinzu kämen tiefsitzende Vertrauensprobleme gegenüber staatlichen Institutionen – eine „postsowjetische Belastungsstörung“, wie Peter es nannte.
Politische Vereinnahmung und demokratische Teilhabe
Im Gespräch mit Publizist Christoph Giesa kam auch das heikle Thema überdurchschnittlicher AfD-Ergebnisse in russlanddeutschen Gemeinden zur Sprache. Peter erläuterte, die Partei habe früh gezielt um diese Gruppe geworben – mit russischsprachigen Angeboten, eigenen Kandidaten und Botschaften, die Verlustängste aufgriffen.
Demokratische Parteien hätten diese Ansprache lange vernachlässigt. „Die AfD nutzt solche Stimmungen geschickt für sich. Trotzdem steht die große Mehrheit der Russlanddeutschen fest auf dem Boden der Demokratie“, betonte Peter.
Erinnerung und Zukunftsfragen
Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer beteiligten sich engagiert an der anschließenden Diskussion. Sie berichteten von Sprachbarrieren, Identitätskonflikten und Erfahrungen mit gesellschaftlicher Separierung.
Der Abend wurde zu einem offenen Forum, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verknüpfte. Für Peter selbst sei „Deutschsein“ heute kein Kriterium von Abstammung oder Sprache mehr.
Dank, Signierstunde, lebhafter Ausklang
Zum Abschluss dankte die Autorin ihrer Familie, „deren große Leistung es war, überlebt zu haben“. Nach fast zwei Stunden signierte sie geduldig Bücher und sprach mit Gästen.
Beim anschließenden Empfang im Schloss klang die Veranstaltung in lebhafter Atmosphäre aus. Die Veranstalter waren sich einig: Das Thema müsse weiter öffentlich diskutiert werden.