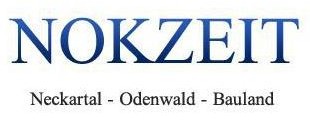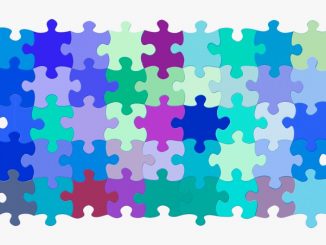Das Informationsangebot der AWN mit einem Rundgang über das Entsorgungszentrum Sansenhecken in Buchen wurde von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern dankbar angenommen. (Foto: Martin Hahn)
Buchen. (pm) Dass eine moderne Deponie nichts mehr mit den ungeordneten Müllkippen „von damals“ zu tun hat, wurde den rund 20 Teilnehmern der AWN-Deponieführung am Dienstagabend schnell klar. Welche umfangreichen Baumaßnahmen und aufwändige Technik für den Betrieb eines Entsorgungszentrums notwendig sind, erfuhren die Teilnehmer aus erster Hand.
AWN-Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter begrüßte die Gäste, man wolle bei diesem Termin den direkten Anwohnern, aber auch interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, sich umfassend über den Betrieb einer Deponie und das Entsorgungszentrum Sansenhecken zu informieren. Thomas Gambke, Bereichsleiter abfallwirtschaftliche Systeme und Benno Ehmann, Leiter Entsorgungsanlagen, erklärten anschließend im Rahmen eines 90-minütigen Rundgangs die verschiedenen Bereiche.
Erste Station war das Eingangsterminal, wo das Material der gewerblichen oder privaten Anlieferer geprüft und je nach Vorgang gewogen wird. Die Kontrolle der Begleitpapiere aller Anlieferungen, gehöre ebenfalls zum Tagesgeschäft. „Unsere wichtige Aufgabe ist es“, so KWiN-Vorstand Sebastian Damm, „Abfälle entsprechend den Umweltschutzbestimmungen fachgerecht zu verarbeiten oder zu entsorgen“.
Am Einbaufeld auf dem eigentlichen Deponiegelände wurde dann der technische Aufbau eines Verfüllabschnittes, sowie das Multibarrierenkonzept, erklärt. Eine rund zwei Meter mächtige Schicht aus Tonerde, Dichtungsbahnen und Füllmaterial sorgen dafür, dass dieses Bauwerk über viele hundert Jahre „dicht“ halte, so Gambke. Die großflächig ausgelegte schwarze Folie sorge dafür, dass kein Oberflächenwasser in den Müllkörper eindringt.
Erst wenn sich dieser nach rund zehn bis fünfzehn Jahren gesetzt hätte, könne mit der aufwändigen Oberflächenabdichtung, die ebenfalls aus mehreren Schichten besteht, begonnen werden. „Wir verfüllen die Deponie nacheinander in rund 40 mal 50 Meter großen Monobereichen“, erläutert Benno Ehmann den Zuhörern.
Das methanhaltige Deponiegas werde erfasst und mithilfe eines Gasmotors verwertet. Der gewonnene Strom reiche für den Eigenbedarf inklusive der Elektrofahrzeuge aus (NZ berichtete). Die Erfassung erfolgt über ein Leitungsnetz im Deponiekörper. „Die Gaserfassung ist aktiver Klimaschutz, da Methangas ein starkes Treibhausgas ist“, so Gambke.
Wurde bis 2005 noch „fast alles“, insbesondere organikhaltiger Haushaltsmüll eingebaut, dürfen seit Mitte 2005 nur noch mineralische Abfälle wie z.B. Gießereialtsande, teerhaltiger Straßenaufbruch, mineralischer Bauschutt, KMF und Asbest, jeweils immer entsprechend den Sicherheitsbestimmungen, eingebaut werden.
Das aktuell genehmigte Deponievolumen würde, so Gambke, nur noch rund zehn Jahre reichen. Deshalb laufe gerade ein Genehmigungsverfahren mit umfänglicher Öffentlichkeitsbeteiligung für eine Erhöhung der Deponie. Dadurch könne man ohne zusätzlichen Geländeverbrauch eine Entsorgungssicherheit für weitere 30 Jahre sicherstellen.
Es sei abzusehen, dass auch weiterhin viel und vielleicht sogar mehr Deponieraum benötigt würde – schon allein der verbaute Asbest in älteren Häusern in Putzen, Klebern, Bodenbelägen, Dichtungen und Eternitplatten zusammen mit den immer strengeren Umweltschutzbestimmungen würden dafür sorgen, so Gambke.
An der Umladestation wird das mit Abfall-LKW gesammelte Material in größere Transporteinheiten umgeladen und dann in entsprechende externe Entsorgungsanlagen abgesteuert. Beispielsweise wird der Rest- und Sperrmüll vorwiegend in das Müllheizkraftwerk der MVV nach Mannheim transportiert, wo Strom erzeugt und ein Fernwärmenetz betrieben wird. „Eine Tonne Restmüll“, so Sebastian Damm, „hat den gleichen Heizwert wie eine Tonne Braunkohle“.
Am „tiefsten Punkt der Deponie“ sorge die Sickerwasserreinigungsanlage dafür, dass Wasser aus dem Müllkörper gereinigt und dann über eine Druckleitung zur Kläranlage nach Buchen gepumpt wird. „Für die Reinigung der Abwässer aus den alten Deponieabschnitten setzen wir Aktivkohle ein“, schloss Benno Ehmann die Ausführungen.